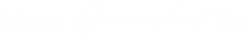Blasenentzündung beim Mann: komplizierter als bei Frauen
Autoren: Dr. med. Michaela Hilburger, Fachärztin für Urologie & Dr. med. Sonia Trowe, Ärztin
Blasenentzündungen kommen bei Männern selten vor und müssen gut abgeklärt werden. Anders als manche unkomplizierten Harnwegsinfektionen können sie nicht in Eigenregie behandelt werden, sondern erfordern stets eine Therapie mit Antibiotika.
Trotz längerer Harnröhre
Dass eine Blaseninfektion (Zystitis) bei Männern seltener als bei Frauen auftritt, liegt am unterschiedlichen Aufbau der Genitalorgane beider Geschlechter. Der im Vergleich zu Frauen größere Abstand zwischen Harnröhreneingang und Darmausgang (Anus) schützt Männer vor Schmierinfektionen aus diesem Bereich. Die längere Harnröhre erschwert zudem das Aufsteigen der Keime in die Blase.
Trotz dieser Schutzfaktoren können aber auch Männer Blasenentzündungen entwickeln. Veränderungen der Vorhaut und Geschlechts- bzw. Analverkehr spielen hier zum Beispiel eine Rolle. Mit zunehmendem Alter nimmt im Allgemeinen die Rate bei Männern deutlich zu. Der Grund hierfür ist oft eine vergrößerte Prostata.
Komplizierte und unkomplizierte Entzündungen
Mediziner teilen Blasen- bzw. Harnwegsinfektionen generell in „kompliziert“ und „unkompliziert“ ein. Ist z.B. der Harntrakt anatomisch verändert oder der Abfluss von Urin behindert, gilt eine Blasenentzündung als kompliziert. Auch Erkrankungen wie ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) oder eine Nierenschwäche können den Verlauf erschweren und müssen bei der Behandlung berücksichtigt werden. Eine Blasenentzündung beim Mann fällt in der Regel unter die Kategorie „kompliziert“,da auch die Prostata mitbeteiligt sein kann.
Typische Symptome: Brennen beim Wasserlassen & Harndrang
Die Symptome einer Blasenentzündung bei Männern ähneln denen bei Frauen. Dazu zählen unter anderem:
- Schmerzen beim Wasserlassen (Algurie)
- häufiger Harndrang mit kleinen Mengen Urin (Pollakisurie)
- ungewollter Urinverlust aufgrund des plötzlicher Harndrangs (Dranginkontinenz)
- eventuell (häufiges) nächtliches Wasserlassen (Nykturie)
Hinzu kommen Schmerzen bei Druck auf den Bereich oberhalb des Schambeins und Bauchkrämpfe.
Mehr dazu lesen Sie hier: Symptome einer Blasenentzündung.
Solange nur die Blase erkrankt ist, haben Betroffene im Bereich der Nieren keine Beschwerden. Grundsätzlich können aber die Bakterien von der Blase in die Nierenbecken aufsteigen und hier zu einer Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis) führen. Dabei handelt es sich um ein schwerwiegenderes Krankheitsbild, das meist mit Fieber und Flankenschmerzen einhergeht und immer einer antibiotischen Therapie bedarf.
Häufig: Mitbeteiligung der Prostata
Prostata und Blase hängen anatomisch eng miteinander zusammen. Kein Wunder, dass oft beide Organe von einer Erkrankung betroffen sind. So kann im Rahmen einer klassischen Blasenentzündung eine Prostatainfektion als Komplikation auftreten; andererseits kann eine ursprüngliche Entzündung der Prostata auch Ursache und Auslöser für immer wieder auftretende Harnwegsinfektionen sein.
Bei schweren, fieberhaften Blasenentzündungen kann der PSA-Wert (prostataspezifisches Antigen) im Blut ansteigen. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Marker für Prostataerkrankungen, der nicht nur bei Krebs erhöht sein kann. Im Rahmen einer Blasenentzündung gilt ein Anstieg dieses Wertes daher als Zeichen dafür, dass auch die Prostata von der Entzündung betroffen ist.
Besonders wenn Männer häufig Harnwegsinfekte entwickeln, müssen Mediziner an eine chronische Entzündung der Prostata denken. Schmerzen im Beckenbereich und ein stockender, tröpfelnder Harnstrahl („Harnstottern“) können ein weiterer Hinweis hierauf sein.
Komplikation: Überlaufblase bei vergrößerter Prostata
Bei älteren Männern ist die Prostata außerdem oft vergrößert. Da die Harnröhre direkt durch sie hindurchführt, kann eine Vergrößerung der Prostata den Abfluss des Urins aus der Blase behindern und einengen. Dies kann zu Blaseninfektionen führen. Zudem kann es durch die Prostatavergrößerung zum vollständigen Stillstand des Harnabflusses aus der Blase kommen. Die Folge ist ein Harnverhalt. Durch diese Anstauung können sich ein bis zwei Liter in der Blase ansammeln. Eine so stark gefüllte Blase ist sehr schmerzhaft.
Bei einer solchen Überlaufblase schafft ein Blasenkatheter, der die Blase entlastet, schnell Abhilfe. Die Symptome bessern sich dadurch häufig schlagartig. Der Katheter wird durch die Harnröhre bis in die Blase vorgeschoben und bleibt dort erst einmal liegen. Alternativ kann der Katheter auch direkt über die Bauchdecke eingelegt werden. Meist muss der Blasenkatheter eine gewisse Zeit lang getragen werden, zum Beispiel bis ein neu verordnetes Medikament zur Reduktion der Prostatavergrößerung wirkt oder eine Operation oder eine Operation erfolgen kann.
Sonderfall: Entzündung bei Blasenkathetern
Ganz unproblematisch sind Blasenkatheter aber auch nicht. Sie bieten Bakterien einen optimalen Einstieg in die Harnwege. Infektionen können so immer wieder auftreten. Deswegen sind strenge Hygienemaßnahmen sehr wichtig. Zudem sollte der Katheter nicht länger als unbedingt nötig verbleiben, um das Infektionsrisiko möglichst zu minimieren. Muss der Katheter aber länger getragen werden und kommt es wiederholt zu Infekten, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Vorbeugung – etwa der Umstieg auf ein sogenanntes geschlossenes Harndrainagesystem, bei dem Keime durch die dichte Verbindung von Katheter und Beutel schlechter eindringen können. Auch das rechtzeitige Entleeren des Auffangbeutels, bevor es zu einem Rückfluss des Urins kommt, zählt zu den empfohlenen Maßnahmen. Eine Antibiotikaprophylaxe wird nicht routinemäßig empfohlen, kann aber in ausgewählten Fällen – etwa bei häufigen symptomatischen Infekten trotz aller anderen Maßnahmen – in Erwägung gezogen werden. In solchen Situationen ist eine urologische Mitbetreuung sinnvoll.
Ausschluss sexuell übertragbarer Infektionen der Harnröhre
Generell müssen Ärzte bei Männern, die über Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen klagen, auch an sexuell übertragbare Infektionen denken. Sie kommen gar nicht so selten vor. Typische Bakterien wie Chlamydien oder Gonokokken (Erreger von Tripper) können zu einer Entzündung der Harnröhre führen, die ebenfalls mit Brennen beim Wasserlassen einhergehen kann. Ein Abstrich auf Bakterien hilft hier weiter.
Diagnostik: Untersuchung vom Urin
Harnwegsinfekte bei Männern müssen genau untersucht werden. Neben dem Abfragen der Symptome und der körperlichen Untersuchung gehören eine Analyse des Urins und das Anlegen einer sogenannten Urinkultur dazu. Einfache Urinteststreifen reichen nicht aus.
Beim Anlegen einer Kultur untersuchen Experten, welche Bakterien sich im Urin anzüchten lassen und analysieren in einem zweiten Schritt, welches Antibiotikum den entsprechenden Keim bekämpfen kann. Die Urinkultur gibt somit wichtige Hinweise darauf, ob ein Medikament gegen die Keime hilft oder nicht.
Ultraschall zur Beurteilung von Blase und Prostata
Bereits in der Basisdiagnostik erfolgt in der Regel eine sonografische Untersuchung, um mögliche Harnabflussstörungen zu erkennen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob nach dem Toilettengang noch Urin in der Blase zurückbleibt (sogenannter Restharn). Außerdem kann man mit dem Ultraschall von außen durch die Bauchdecke auch eine erste Einschätzung zur Größe der Prostata gewinnen.
Weiterführende Untersuchungen der Prostata, wie etwa eine Tastuntersuchung oder eine Ultraschalluntersuchung über den Enddarm, erfolgen in der akuten Phase in der Regel nicht, da sie schmerzhaft sein und den Infekt verschlimmern können. Sie werden – wenn beispielsweise der Verdacht auf eine vergrößerte Prostata besteht – erst nach Abklingen der Beschwerden im weiteren Verlauf durchgeführt.
Extratests: Blutanalyse und Computertomographie
Wenn Infekte immer wieder auftreten oder andere Komplikationen wie eine verschlechtere Nierenfunktion hinzukommen, müssen Ärzte weitere Untersuchungen durchführen. Dazu zählt unter anderem eine Blutuntersuchung, bei der Entzündungs- und Nierenwerte kontrolliert werden.
Treten zusätzlich krampfartige Nierenkoliken auf, kommt gegebenenfalls eine Computertomografie (CT) zum Einsatz. Es kann zum Beispiel Steine in Nierenbecken oder Harnleitern zeigen. Weitere Spezialverfahren wie Blasenspiegelungen oder Kernspinuntersuchungen kommen in ausgewählten Fällen und nur bei bestimmten Fragestellungen in Betracht, nicht aber routinemäßig bei einfachen Blasenentzündungen.
Antibiotika: bei Männern ein Muss
Antibiotika sind bei Infektionen der Harnwege bei Männern unumgänglich. Das gilt sowohl für einfache Blasenentzündungen als auch für Infektionen im Nierenbecken. Häufigster Auslöser ist wie bei Frauen das Darmbakterium Escherichia coli.
Es ist generell wichtig, Antibiotika mit Bedacht einzusetzen und den aktuellen Behandlungsempfehlungen von Experten zu folgen. Resistente Keime, die sich nur noch schwer bekämpfen lassen, nehmen leider weiter zu.
Mehr dazu hier: Antibiotika bei Blasenentzündung.
Quellen
- Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Brennen beim Wasserlassen. S3-Leitlinie und Anwenderversion der S3-Leitlinie Harnwegsinfektionen. AWMF-Registernr.: 053-001. July 2018. (DEGAM guideline no. 1).
- Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU). Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Update 2017. AWMF-Registernr.: 043-044. April 2017.
- Manski, D. Urologielehrbuch (2020).
- Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie. Fachrichtlinie Nr. 14: Hygieneempfehlungen zur Prävention Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen. Version 6.0. Steiermärkische Krankenanstalten; Juni 2022. Zugriff am 3. Juli 2025. Verfügbar unter: https://www.krankenhaushygiene.at.